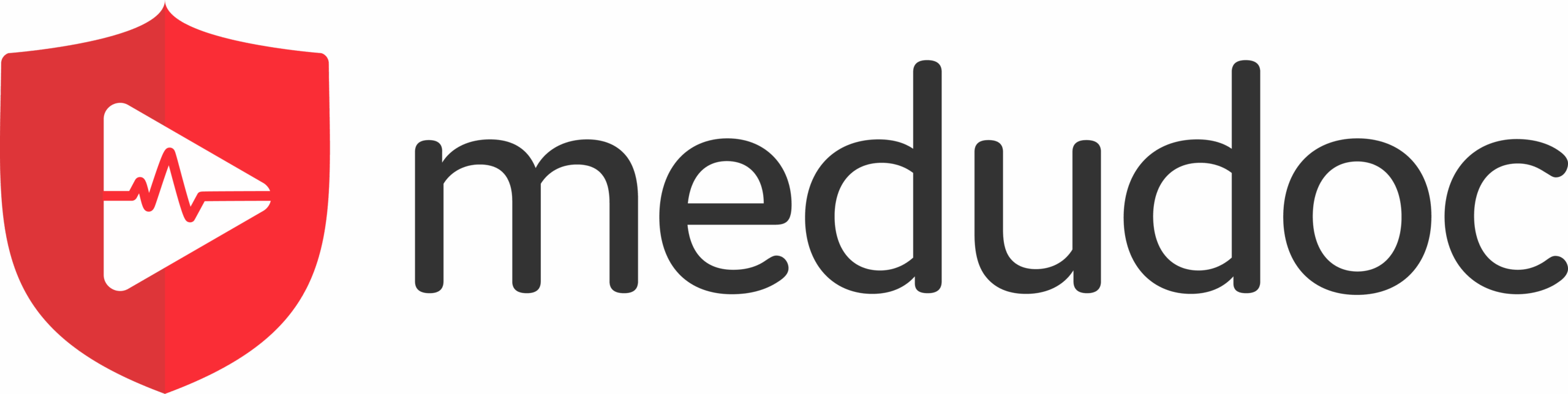Informierte Einwilligung
(engl. Informed Consent)
Grundlagen und Informationen zur Informierten Einwilligung (Informed Consent) in der medikolegalen Rechtspraxis in Deutschland und Österreich.
1. Einführung: Begriffsklärung Informierte Einwilligung / Informed Consent
Die informierte Einwilligung – englisch Informed Consent – bezeichnet im medizinischen Kontext die vom Patienten bewusst und nach Aufklärung erteilte Zustimmung zu einer Behandlung. Grundlage ist das Selbstbestimmungsrecht: Nur Behandlungen, die vom Willen des Patienten getragen sind, dürfen durchgeführt werden. Vor jedem Eingriff muss der Patient also informiert – d.h. umfassend über Diagnose, Art und Ablauf der Maßnahme, Risiken, Alternativen und Prognose aufgeklärt – und anschließend um sein Einverständnis gebeten werden. Ohne wirksame Einwilligung würde der Eingriff rechtlich als Körperverletzung gelten. Die informierte Einwilligung ist daher ein zentraler Bestandteil der ärztlichen Sorgfaltspflicht und Patientenrechte. Sie stellt sicher, dass Patient:innen eigenverantwortlich und auf Basis verständlicher Informationen in eine Behandlung einwilligen können. Dieses Prinzip hat sich international als medizin-ethischer Standard etabliert und ist in Deutschland und Österreich rechtlich klar verankert.
2. Rechtliche Grundlagen in Deutschland (BGB, Patientenrechtegesetz, StGB)
In Deutschland ist die informierte Einwilligung seit dem Patientenrechtegesetz 2013 ausdrücklich im Zivilrecht geregelt. § 630d BGB schreibt vor, dass vor jeder medizinischen Maßnahme die Einwilligung des Patienten einzuholen ist – und zwar nach ordnungsgemäßer Aufklärung gemäß § 630e BGB. Diese Einwilligung ist nur wirksam, wenn der Patient vorher über alle wesentlichen Umstände informiert wurde (Aufklärungspflicht). Praktisch bedeutet das: Ohne Aufklärung keine gültige Einwilligung. Ärzte müssen den Patienten insbesondere über Art, Umfang, Durchführung, absehbare Folgen und Risiken der Behandlung sowie Notwendigkeit, Dringlichkeit, Erfolgsaussichten und Behandlungsalternativen aufklären. Die Aufklärung muss mündlich, rechtzeitig und in verständlicher Weise erfolgen. Patienten haben ein Recht, in verständlicher Sprache und ohne medizinischen Fachjargon informiert zu werden; bei Sprachbarrieren sind Übersetzungen oder Dolmetscher erforderlich.
Ohne wirksame Einwilligung wäre jede Behandlung rechtswidrig. Strafrechtlich gilt eine medizinische Behandlung als Tatbestand der Körperverletzung (§ 223 StGB), die aber durch die Einwilligung gerechtfertigt ist. § 228 StGB erlaubt Körperverletzungen mit Einwilligung, soweit kein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt. Konkret: Jeder ärztliche Heileingriff stellt zunächst eine Körperverletzung dar, die jedoch durch die vorherige, ordnungsgemäß aufgeklärte Einwilligung des Patienten straflos wird. Fehlt diese Einwilligung – etwa weil die Aufklärung unzureichend war – kann selbst ein medizinisch erfolgreicher Eingriff als vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung geahndet werden. Dieses Prinzip hat der Bundesgerichtshof prägnant formuliert: „Jede ärztliche Heilbehandlung […] stellt eine Körperverletzung dar, wenn sie ohne wirksame Einwilligung des Patienten erfolgt.“.
Zivilrechtlich führt ein Verstoß gegen die Aufklärungspflicht dazu, dass keine wirksame Einwilligung vorliegt – die Behandlung ist dann rechtswidrig und kann Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche begründen. § 630e BGB konkretisiert die Aufklärungspflichten im Behandlungsvertrag, und § 630h BGB regelt die Beweislast: Der Behandelnde muss im Streitfall beweisen, dass er den Patienten einwilligungsfähig aufgeklärt hat. Kann der Arzt mangelhafte Aufklärung nicht widerlegen, wird zugunsten des Patienten vermutet, dass dieser bei ausreichender Aufklärung nicht eingewilligt hätte – was die Haftung begründet (Aufklärungsfehler). Seit Einführung des Patientenrechtegesetzes sind diese Grundsätze im BGB festgeschrieben, was die Rechtsposition von Patienten stärkt.
Zusätzlich gelten spezielle Vorgaben für besondere Situationen: Bei nicht einwilligungsfähigen Patienten (z.B. Bewusstlosen oder dementen Personen) darf ein Eingriff nur mit Einwilligung eines rechtlichen Vertreters erfolgen (gesetzlicher Betreuer oder Bevollmächtigter), sofern nicht ein schriftlicher Patientenverfügung im Sinne von § 1827 BGB vorliegt, die die Behandlung ausdrücklich gestattet oder untersagt. Im Notfall (unaufschiebbare Maßnahme) darf auch ohne vorherige Einwilligung behandelt werden, wenn dies dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht – beispielsweise um Lebensgefahr abzuwenden.
Zusammengefasst beruht in Deutschland jede medizinische Behandlung auf einem Behandlungsvertrag (§ 630a BGB), dessen Wirksamkeit die informierte Einwilligung des Patienten voraussetzt. Die Rechtsnormen (§§ 630d, 630e BGB) verpflichten Ärzte zu einer umfassenden Patientenaufklärung als Grundlage der Einwilligung. Ohne Einhaltung dieser Pflichten machen sich Ärzte zivilrechtlich und strafrechtlich angreifbar. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Aufklärung in der Praxis.
3. Rechtliche Grundlagen in Österreich (ABGB, ÄrzteG, PatVG)
Auch in Österreich ist die informierte Einwilligung gesetzlich verankert. Eine entscheidende Neuerung brachte das Erwachsenenschutz-Gesetz 2018, das die Patientenrechte im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) präzisierte. § 252 ABGB bestimmt, dass eine entscheidungsfähige volljährige Person nur selbst in eine medizinische Behandlung einwilligen kann. Niemand sonst (z.B. Angehörige) darf anstelle eines einwilligungsfähigen Patienten gültig einwilligen – Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts. Ärztliche Maßnahmen dürfen nur mit Zustimmung des informierten Patienten durchgeführt werden. Fehlt die Entscheidungsfähigkeit (z.B. bei Bewusstlosigkeit oder schwerer geistiger Beeinträchtigung), regelt § 253 ABGB das Vorgehen: Dann bedarf es der Zustimmung eines Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreters (früher: Sachwalter), der den mutmaßlichen Willen des Patienten berücksichtigt. Ärzte sind angehalten, wenn möglich den Patienten trotz eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit in die Aufklärung einzubeziehen und zu unterstützen. In akuten Notfällen gilt eine ähnliche Ausnahme wie in Deutschland: Ist eine sofortige Behandlung nötig, darf diese auch ohne vorherige Aufklärung und Zustimmung erfolgen, wenn der Aufschub das Leben oder die Gesundheit gravierend gefährden würde.
Eine Besonderheit des österreichischen Rechts ist die ausdrückliche Regelung zur Einwilligung Minderjähriger in § 173 ABGB. Dort wird festgelegt, dass ein einsichts- und urteilsfähiges minderjähriges Kind selbst in eine medizinische Behandlung einwilligen kann. Bei schwerwiegenden Eingriffen, die mit einer nachhaltigen Beeinträchtigung einhergehen, ist allerdings zusätzlich die Zustimmung des Obsorgeberechtigten (Elternteils) erforderlich, selbst wenn der Minderjährige entscheidungsfähig ist. Diese doppelte Absicherung soll Kinder bei riskanten Eingriffen besonders schützen. Ist das Kind nicht entscheidungsfähig, entscheiden die Eltern (bzw. der gesetzliche Vertreter) im wohlverstandenen Interesse des Kindes. Im Notfall (Gefahr im Verzug) darf auch ohne Einwilligung behandelt werden, wenn das Einholen der Zustimmung nicht möglich ist und Aufschub das Leben oder die Gesundheit des Kindes gefährden würde.
Das österreichische Ärztegesetz 1998 (ÄrzteG) verpflichtet Ärztinnen und Ärzte zur sorgfältigen Aufklärung und Dokumentation. Zwar findet sich im Gesetz kein einzelnes Paragraphen-Äquivalent zu § 630e BGB, doch ergibt sich die Aufklärungspflicht aus der generellen Sorgfaltspflicht und aus Patientenrechten. So haben Patient:innen etwa Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte und umfassende Information. § 51 ÄrzteG regelt die Dokumentationspflicht (siehe Abschnitt 6) und impliziert damit, dass alle wesentlichen Maßnahmen – inklusive Aufklärungsgespräche und Einwilligungen – aufzuzeichnen sind. Die österreichische Patientencharta und Standesrichtlinien der Ärztekammer fordern ebenfalls eine verständliche Aufklärung als Voraussetzung für die Patienteneinwilligung.
Ein wichtiger Bestandteil des österreichischen Rechtsrahmens ist das Patientenverfügungs-Gesetz (PatVG). Seit 2006 können Patienten in Österreich mittels Patientenverfügung im Voraus festlegen, welche medizinischen Maßnahmen sie im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit ablehnen. Es wird zwischen verbindlichen und beachtlichen Patientenverfügungen unterschieden. Eine verbindliche Patientenverfügung erfüllt strenge Formvorschriften: Sie muss nach umfassender ärztlicher Aufklärung über Wesen und Folgen schriftlich erstellt und vor einem Rechtsanwalt, Notar oder Patientenvertreter unterzeichnet werden. Sie gilt max. 8 Jahre und muss dann erneuert werden (wiederum mit ärztlicher Beratung). Lehnt ein nicht entscheidungsfähiger Patient in einer verbindlichen Patientenverfügung eine Behandlung ab, darf diese nicht durchgeführt werden – der Arzt muss den Willen respektieren. Die verbindliche Verfügung hat also ähnliches Gewicht wie eine aktuell erklärte Einwilligung. Liegt nur eine beachtliche (nicht alle Formalien erfüllende) Patientenverfügung vor, muss der Arzt sie zumindest als wichtigen Anhaltspunkt für den Patientenwillen berücksichtigen.
Zusammengefasst entspricht die Rechtslage in Österreich im Grundsatz der deutschen: Ohne Einwilligung keine Behandlung. Das ABGB betont die persönlichen Entscheidungsrechte, das PatVG regelt Vorausverfügungen, und das ÄrzteG verpflichtet zur Dokumentation und Auskunft. Unterschiede liegen in den Details der Ausführung (siehe Abschnitt 4).
4. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Österreich
Gemeinsamkeiten: Beide Länder stellen die Patientenautonomie ins Zentrum. Eine medizinische Behandlung ist nur rechtmäßig, wenn der Patient nach ausreichender Aufklärung freiwillig eingewilligt hat. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich gilt: Ein ärztlicher Eingriff ohne Einwilligung erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung und zieht rechtliche Konsequenzen nach sich. Die Aufklärung muss in beiden Ländern verständlich, vollständig und rechtzeitig erfolgen. Auch in der Praxis ähneln sich die Anforderungen: Ein formelles Unterschreiben eines Aufklärungsbogens allein reicht nirgends aus – es bedarf immer des persönlichen Arzt-Patienten-Gesprächs. Zudem kennen beide Rechtssysteme Ausnahmen in Notfällen (Gefahr in Verzug) und Vertreterregelungen bei einwilligungsunfähigen Personen. Patientenverfügungen sind sowohl in Deutschland (geregelt in §§ 1827, 1901a BGB) als auch in Österreich (PatVG) anerkannt, um den Patientenwillen im Voraus festzulegen.
Unterschiede: Die gesetzliche Verankerung ist unterschiedlich strukturiert. In Deutschland wurden die Patientenrechte durch das 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz vor allem im BGB (§§ 630a–630h) gebündelt. Österreich hat hingegen entsprechende Regelungen im ABGB (§§ 252–255) und speziellen Gesetzen (z.B. PatVG) verteilt. Auch die Einwilligung Minderjähriger ist ausdrücklich nur im österreichischen Recht (§ 173 ABGB) detailliert geregelt, während in Deutschland hierzu keine eigene Norm im BGB existiert – dort wird die Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger über die Einsichtsfähigkeit im Einzelfall und die allgemeine Personenfürsorge der Eltern nach § 1626 BGB bestimmt. Faktisch verlangen aber beide Länder bei Minderjährigen eine der Reife des Kindes angepasste Beteiligung am Entscheid und die Zustimmung der Eltern, insbesondere bei schwerwiegenden Eingriffen.
Ein weiterer Unterschied liegt in den Formvorschriften für Patientenverfügungen: In Österreich sind verbindliche Patientenverfügungen nur gültig, wenn sie notariell oder anwaltlich beglaubigt und nach vorheriger ärztlicher Aufklärung erstellt wurden. Zudem haben sie eine Befristung (8 Jahre). In Deutschland dagegen sind Patientenverfügungen formfrei schriftlich möglich und unbegrenzt gültig (§§ 1901a, 1901b BGB), müssen aber inhaltlich ausreichend konkret sein, um im Einzelfall bindend zu sein (laut höchstrichterlicher Rechtsprechung). Diese strengeren Formalien in Österreich sollen die Verbindlichkeit erhöhen, erfordern aber mehr Aufwand bei der Erstellung.
Auch im Strafrecht gibt es Nuancen: In Deutschland wird die Einwilligung als Rechtfertigungsgrund anerkannt (§ 228 StGB), analog auch in Österreich (§ 90 StGB erlaubt gefährliche HV mit Einwilligung unter bestimmten Umständen). Praktisch relevant sind diese Unterschiede kaum – in beiden Ländern schützt eine ordnungsgemäße Einwilligung den Arzt vor Strafverfolgung.
Hinsichtlich der Dokumentation bestehen ebenfalls Parallelen: Deutschland normiert sie in § 630f BGB detailliert, Österreich im ÄrzteG § 51. Allerdings schreibt Österreich traditionell eine längere Aufbewahrung klinischer Aufzeichnungen (mindestens 30 Jahre in Krankenanstalten) vor, während in Deutschland nach der Musterberufsordnung 10 Jahre üblich sind (für Röntgen sogar 30 Jahre). Solche Verwaltungsdetails unterscheiden sich, berühren aber nicht den Kern der informierten Einwilligung.
Zusammenfassend lassen sich Deutschland und Österreich im Bereich der informierten Einwilligung als sehr ähnlich charakterisieren: Beide folgen dem internationalen Standard des Informed Consent. Unterschiede bestehen v.a. in der gesetzestechnischen Umsetzung und einigen formalen Anforderungen (etwa bei Minderjährigen und Vorausverfügungen), weniger im grundsätzlichen Vorgehen.
5. Ablauf der informierten Einwilligung in der Praxis
Wie läuft eine informierte Einwilligung typischerweise ab?
Zunächst führt der behandelnde Arzt ein Aufklärungsgespräch mit dem Patienten. In diesem Gespräch erläutert der Arzt verständlich die Diagnose (Befund oder vorläufige Einschätzung), den vorgesehenen Therapie- oder Eingriffsvorschlag, dessen Ablauf und Ziel. Risiken und mögliche Komplikationen werden angesprochen – hierbei sowohl häufige, leichte Nebenwirkungen als auch seltene, aber schwere Risiken, sofern sie für die Entscheidung relevant sind. Ebenso müssen Behandlungsalternativen aufgezeigt werden, z.B. alternative Methoden oder die Möglichkeit, vorerst abzuwarten, falls medizinisch vertretbar. Der Arzt erläutert die Erfolgsaussichten der Maßnahme und was passiert, wenn nichts unternommen wird (Konsequenzen eines Therapieverzichts). Wichtig ist, dass diese Informationen ehrlich, ausgewogen und laienverständlich vermittelt werden – der Patient soll die Chance haben, Nutzen und Risiken abzuwägen.
Gemäß § 630e Abs. 2 BGB muss die Aufklärung mündlich durch den Arzt oder eine qualifizierte Person erfolgen, rechtzeitig vor dem Eingriff, damit der Patient genügend Bedenkzeit hat, und für den Patienten verständlich. Ergänzend dürfen schriftliche Unterlagen (Broschüren, Aufklärungsbögen) gereicht werden, aber sie ersetzen nie das persönliche Gespräch. Der Patient erhält auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Unklarheiten zu klären – das Gespräch sollte kein Monolog des Arztes sein, sondern ein Dialog. Idealerweise werden Patienten aktiv ermutigt, alle ihre Fragen (z.B. „Wie lange werde ich arbeitsunfähig sein?“, „Welche Alternativen habe ich?“) zu stellen.
Nach dem Gespräch wird häufig ein schriftlicher Aufklärungsbogen eingesetzt, der die wesentlichen Punkte zusammenfasst. Diesen liest der Patient (ggf. zuhause in Ruhe) und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das Aufklärungsgespräch stattgefunden hat und er die Informationen verstanden hat. Wichtig: Die Unterschrift allein ist nicht die Einwilligung, sondern nur Beleg für das Aufklärungsgespräch. Die eigentliche Einwilligung fragt der Arzt mündlich ab – beispielsweise unmittelbar vor dem Eingriff: „Sind Sie mit der vorgeschlagenen Operation unter den besprochenen Bedingungen einverstanden?“ Erst wenn der Patient dies eindeutig bejaht (oder schriftlich durch Unterschrift auf dem Einwilligungsformular erklärt), liegt die wirksame Einwilligung vor. In der Praxis werden Aufklärung und Einwilligung oft in einem Vorgang dokumentiert: Der Patient unterschreibt ein Formular, das sowohl den Gesprächsinhalt protokolliert als auch die Einwilligungserklärung enthält.
Der zeitliche Ablauf ist dabei bedeutsam. Patienten sollen ausreichend Zeit zum Nachdenken haben. Bei planbaren Eingriffen wird empfohlen, dass das Aufklärungsgespräch mindestens einen Tag vor der Operation stattfindet, damit der Patient nicht unter Druck spontan entscheiden muss. Direkt vor dem Eingriff fragt der Arzt dann nochmals nach dem Einverständnis. Deutsche Gerichte fordern ausdrücklich, dass zwischen Aufklärungsgespräch und Unterzeichnung der Einwilligungserklärung genügend Bedenkzeit liegen muss – eine sofortige Unterschrift direkt nach dem Gespräch kann im Regelfall unwirksam sein. Diese Praxis soll sicherstellen, dass Patienten wohlüberlegt entscheiden können.
Im Alltag setzen viele Kliniken standardisierte Aufklärungsbögen (oft vom Medizinischen Verlag) ein, die pro Eingriff die typischen Risiken auflisten. Diese Bögen sind Hilfsmittel zur Vollständigkeit, ersetzen aber nie das individuelle Gespräch. Ärzt:innen müssen die Informationen immer auf den konkreten Patienten zuschneiden (z.B. besondere Risiken bei Vorerkrankungen erläutern). Auch ist es ihre Aufgabe zu prüfen, ob der Patient alles verstanden hat – ggf. müssen medizinische Sachverhalte in einfacheren Worten oder mit Hilfe von Zeichnungen/Modellen erklärt werden.
Nach umfassender Aufklärung gibt der Patient die Einwilligung – in der Regel schriftlich (Unterschrift unter dem Einwilligungsformular), teilweise auch mündlich (etwa in Notfällen oder im ambulanten Gespräch, was dann in der Akte vermerkt wird). In jedem Fall wird die Einwilligungserklärung in der Patientenakte festgehalten.
Digitale Tools in der Praxis: Moderne Ansätze, wie von medudoc angeboten, integrieren digitale Elemente in diesen Ablauf. Beispielsweise können Patienten vorab Aufklärungsvideos zu ihrem Eingriff erhalten, die in Ruhe zu Hause angeschaut werden können. Solche videobasierten Patientenaufklärungen bereiten den Patienten auf das Gespräch vor: medizinische Sachverhalte werden visuell und in einfacher Sprache erklärt. Dadurch verstehen Patienten oft besser, was auf sie zukommt, und können gezielter Fragen formulieren. Beim folgenden Arztgespräch kann der Arzt auf einem höheren Wissensniveau des Patienten aufbauen und sich auf individuelle Aspekte konzentrieren. Wichtig bleibt: Das persönliche Arztgespräch muss dennoch stattfinden – digitale Inhalte sind eine Vorbereitung und Ergänzung, kein Ersatz. Nach heutigem Recht ist die mündliche Aufklärung durch einen Arzt unerlässlich.
Nach dem Gespräch und der Klärung aller Fragen erfolgt die digitale oder analoge Dokumentation und Signatur. Mit fortschreitender Digitalisierung ist es inzwischen möglich, die Einwilligung elektronisch unterschreiben zu lassen – etwa auf einem Tablet oder via Weblink mit qualifizierter elektronischer Signatur. Diese digitalen Unterschriften können, wenn sie den Standards (z.B. eIDAS in der EU) genügen, rechtlich der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt sein. Medudoc z.B. bietet eine Fernsignatur-Funktion an, mit der Patient und Arzt ortsunabhängig die Einwilligung digital unterzeichnen können. Damit lässt sich der gesamte Prozess – Information, Fragerunde, Bestätigung – in einem digitalen Workflow abbilden, was insbesondere bei Telemedizin-Anwendungen (z.B. Vorbereitung eines Eingriffs per Videosprechstunde) relevant ist.
6. Anforderungen an die Dokumentation
Eine lückenlose Dokumentation der Aufklärung und Einwilligung ist aus zwei Gründen wichtig: rechtlich, um im Streitfall den Nachweis führen zu können, und therapeutisch, um für den weiteren Behandlungsverlauf relevante Informationen festzuhalten. In Deutschland schreibt § 630f BGB die Dokumentation der Behandlung vor. Demnach muss der Arzt zeitnah eine Patientenakte führen, in der sämtliche aus fachlicher Sicht wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufgezeichnet werden. Dazu gehören insbesondere Anamnese, Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien – und ausdrücklich auch die Aufklärungsgespräche und Einwilligungen. Zwar wird die Aufklärung in § 630f nicht wörtlich genannt, aber § 630h Abs.2 BGB macht deutlich, dass der Arzt die Einwilligung und Aufklärung beweisen muss; daher ist ihre Dokumentation essentiell. Alles, was nicht dokumentiert ist, gilt im Zweifelsfall als nicht geschehen. Aus diesem Grund werden Aufklärungsbögen und Einwilligungsformulare stets zur Patientenakte genommen.
Die Dokumentation sollte enthalten: Datum und Uhrzeit des Aufklärungsgesprächs, Name des aufklärenden Arztes, Inhalt der Aufklärung (wichtigste Punkte: Diagnose, vorgeschlagene Maßnahme, Risiken, Alternativen), eventuelle Besonderheiten (z.B. Verständnisschwierigkeiten, Rückfragen des Patienten) und das Ergebnis – also ob der Patient eingewilligt hat oder nicht. Idealerweise unterschreiben sowohl Patient als auch Arzt das Protokoll bzw. Formular. § 630f Abs. 1 BGB verlangt, dass die Dokumentation während oder unmittelbar nach der Behandlung erfolgt – das Gespräch sollte also zeitnah niedergeschrieben werden, um Vollständigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten. Spätere Ergänzungen oder Korrekturen müssen erkennbar sein (keine manipulative Änderung der Akte).
In Österreich regelt § 51 ÄrzteG die Dokumentationspflicht: Ärzte sind verpflichtet, über jede Behandlung Aufzeichnungen zu führen – inklusive Zustand bei Übernahme, Diagnose, Verlauf und Art und Umfang der Leistungen. Auch hier wird implizit die Aufklärung erfasst, denn sie ist Teil der Leistung. Patienten haben das Recht, Einsicht in diese Dokumentation zu nehmen oder Kopien zu erhalten, was betont, dass die Unterlagen vollständig und verständlich sein sollten. Die Aufbewahrungsfristen in Österreich sind je nach Bereich unterschiedlich (für Krankenanstalten meist 30 Jahre, niedergelassene Ärzte 10 Jahre Mindestfrist).
Dokumentationsanforderungen im Überblick:
- Vollständigkeit: Alle wesentlichen Informationen und Entscheidungen (inkl. Einwilligung) festhalten.
- Zeitnähe: sofort oder zeitnah dokumentieren, um Gedächtnislücken vorzubeugen.
- Transparenz: Patienten dürfen Dokumentation einsehen; diese sollte daher sachlich und verständlich sein (wertfreie Sprache, keine Abkürzungen, die Außenstehende nicht verstehen).
- Manipulationssicherheit: Änderungen oder Ergänzungen müssen nachvollziehbar sein (z.B. durch Datum/Zeit und Kürzel kenntlich gemacht).
- Aufbewahrung: in DE mind. 10 Jahre (gesetzlich für Röntgenaufzeichnungen 30 Jahre), in AT oft länger; digital archivieren erfordert Schutz vor Verlust.
Die Dokumentation dient nicht nur der Absicherung des Arztes im Haftungsfall, sondern auch der Kontinuität der Behandlung. Ein lückenhaft dokumentiertes Aufklärungsgespräch kann juristisch als Aufklärungsfehler gewertet werden – im Prozess wird dann angenommen, dass die Aufklärung unzureichend war. Umgekehrt kann eine gut dokumentierte Einwilligung (unterschriebener Bogen mit Gesprächsnotiz) ein entscheidender Beleg sein, dass der Patient informiert zugestimmt hat. Moderne digitale Lösungen dokumentieren den Prozess oft automatisch mit: z.B. speichert medudoc Zeitpunkt und Inhalt der bereitgestellten Videos sowie die digitale Unterschrift, was die Nachweisführung erleichtern kann.
7. Herausforderungen und häufige Fehler in der Praxis
Die Umsetzung der informierten Einwilligung ist anspruchsvoll und in der Hektik des Klinik- und Praxisalltags treten immer wieder Fehler auf. Hier einige häufige Herausforderungen und Stolperfallen:
- Zeitmangel und Routine: Ärzten stehen pro Patient oft nur wenige Minuten zur Verfügung. Die Gefahr besteht, dass Aufklärungsgespräche verkürzt oder als lästige Formalität behandelt werden. Ein Copy-Paste von Standardrisiken ohne auf den individuellen Fall einzugehen, wird der Pflicht jedoch nicht gerecht. Jede*r Patient:in bringt andere Voraussetzungen und Ängste mit – darauf muss eingegangen werden. Auch darf bei häufig durchgeführten Eingriffen die Routine nicht zu Nachlässigkeit führen: Jeder Patient hat Anspruch auf geduldige Erklärung, egal wie oft der Arzt denselben Eingriff schon erläutert hat.
- Fachjargon und Verständlichkeit: Ein klassischer Fehler ist die Überfrachtung mit medizinischen Fachbegriffen. Begriffe wie „Laparo-endoskopische Cholezystektomie“ sagen einem Laien nichts – hier muss der Arzt in Alltagssprache übersetzen („operative Entfernung der Gallenblase durch Schlüssellochtechnik“). § 630e Abs. 2 Nr. 3 BGB verlangt explizit eine verständliche Aufklärung. Häufig verstehen Patienten zwar im Moment des Gesprächs gefühlt alles, trauen sich aber nicht nachzufragen. Es ist Aufgabe des Arztes, durch Nachfragen (z.B. „Können Sie mir in eigenen Worten wiedergeben, was wir vorhaben?“) sicherzustellen, dass die Informationen wirklich angekommen sind.
- Unzureichende Risikodarstellung: Ein Aufklärungsfehler liegt oft darin, bestimmte Risiken zu verschweigen oder zu verharmlosen. Hier gibt es eine rechtliche Grenze: Sehr seltene Risiken (<1‰) müssen nur dann erwähnt werden, wenn sie für den konkreten Eingriff typisch und gravierend sind (z.B. tödliche Narkosezwischenfälle, auch wenn extrem selten, müssen angesprochen werden, weil es um Leben und Tod geht). Häufige oder mittelschwere Risiken müssen immer erwähnt werden. Ein häufiger Fehler ist es, Alternativen nicht zu nennen – selbst wenn nur eine andere Klinik mit experimenteller Methode oder der Verzicht auf Behandlung infrage kommt, sollte der Patient diese Option kennen. Wird etwa eine neue OP-Methode angewandt, muss der Patient erfahren, dass sie neu ist und es eventuell wenig Langzeiterfahrung gibt (damit er ggf. eine etablierte Methode als Alternative wählen kann).
- Timing und Bedenkzeit: In der Praxis passiert es, dass Patienten sehr spät oder im Zustand psychischer Belastung aufgeklärt werden – etwa erst auf dem Operationstisch oder kurz vorher unter Zeitdruck. Dies widerspricht den Anforderungen. Eine typische falsche Vorgehensweise: Dem Patienten wird abends um 22 Uhr für eine morgens geplante OP der Aufklärungsbogen zum Unterschreiben vorgelegt, ohne dass ein echtes Gespräch stattfand. Oder die Einwilligung wird dem sedierten Patienten im Vorraum abgenommen. Solche Versäumnisse können zur Unwirksamkeit der Einwilligung führen. Gerichte fordern ausreichend Abstand zwischen Aufklärung und Entscheidung – in der Regel mindestens am Vortag bei elektiven Eingriffen.
- Delegation an ungeeignetes Personal: Zwar darf ein erfahrener Assistenzarzt oder ein anderer approbierter Arzt das Aufklärungsgespräch führen (wenn ausreichend sachkundig in dem Gebiet), aber die Aufklärung einer komplexen Operation an Pflegepersonal zu delegieren, ist unzulässig. Auch das einfache Aushändigen von Broschüren ohne Arztgespräch ist ein Fehler. Der persönlich aufklärende Arzt muss ausreichend qualifiziert sein, alle Fragen beantworten zu können. Er muss zudem die Aufklärungspflicht vollständig kennen. Ein Beispiel: Ein Chirurg klärt operativ auf, vergisst aber die Alternative einer nichtoperativen Behandlung zu erwähnen, weil dies eher in den Bereich eines Internisten fällt – auch das wäre ein Aufklärungsfehler.
- Dokumentationsmängel: Ein oft erst im Nachhinein bemerkter Fehler ist die lückenhafte Dokumentation des Aufklärungsvorgangs. Im Klinikalltag unterschreiben Patienten manchmal das Formular, aber der Abschnitt „Gespräch geführt durch Dr. … am …“ bleibt leer, oder der Bogen landet nicht in der Akte. Wenn später der Patient behauptet „Man hat mir nichts erklärt, ich hab nur etwas unterschrieben“, steht der Arzt ohne saubere Doku schlecht da. Laut Gesetz trägt der Arzt die Beweislast. Deshalb gilt: „Wer schreibt, der bleibt.“ Jede Aufklärung ist sorgfältig zu dokumentieren (siehe Abschnitt 6). Ein häufiger Fehler ist auch, im Ernstfall ausschließlich auf den unterschriebenen Bogen zu verweisen – Gerichte messen einem unzureichend aufgeklärten, aber unterschriebenen Formular wenig Wert bei. Entscheidend ist, ob tatsächlich aufgeklärt wurde. Die Unterschrift belegt nur, dass ein Gespräch stattfand, nicht dessen Qualität. Daher hilft die beste Dokumentation wenig, wenn die Aufklärung selbst mangelhaft war.
- Sprach- und Kulturbarrieren: In der Praxis treffen Ärzte oft auf Patienten, die der Landessprache nicht mächtig sind oder aus kulturellen Gründen Kommunikationshürden haben. Ein häufiger Fehler ist es, solche Patienten ohne Dolmetscher aufklären zu wollen oder Angehörige als Übersetzer herzanzuziehen, die ggf. selbst fachlich überfordert sind. Das Ergebnis kann ein eklatantes Missverständnis sein. Hier ist es geboten, professionelle Übersetzungshilfen zu nutzen oder schriftliche Materialien in der Muttersprache bereitzustellen. Auch die non-verbale Kommunikation spielt eine Rolle: Ein verängstigter Patient nimmt vielleicht Informationen nicht richtig auf – da hilft ein einfühlsames Gesprächsklima.
Zusammengefasst passieren Aufklärungsfehler meist durch Zeitdruck, Standardisierung und Annahmen, der Patient werde schon verstanden haben. Praxis-Tipp: Den Aufklärungsprozess immer mit der gleichen Sorgfalt durchführen, als würde man später vor Gericht danach gefragt – also vollständig, individuell und dokumentiert. Patienten sollten niemals das Gefühl haben, lästig zu sein, wenn sie nachfragen. Eine Frage, die unbeantwortet bleibt, kann später juristisch bedeutsam werden. Ebenso sollte das Team (Ärzte und Pflege) geschult sein, die Bedeutung der informierten Einwilligung zu kennen – z.B. darf keine OP-Schwester einen Patienten in den OP fahren, der sagt „Ich bin mir doch nicht sicher“, ohne den Arzt zu informieren.
8. Zunehmende Relevanz durch Digitalisierung und Telemedizin
Die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen beeinflusst auch die informierte Einwilligung. Einerseits eröffnen digitale Tools neue Möglichkeiten, die Aufklärung zu verbessern, andererseits stellen sie neue Anforderungen an den rechtlichen Rahmen.
Digitale Aufklärungsmaterialien: Wie in Abschnitt 5 erwähnt, kommen immer häufiger multimediale Inhalte zum Einsatz – Videos, Animationen, interaktive Apps – um Patienten aufzuklären. Studien zeigen, dass audiovisuelle Informationen die Verständnis- und Behaltensquote deutlich erhöhen können. Komplexe Sachverhalte (z.B. ein geplanter Herzkatheter-Eingriff) lassen sich in einem Erklärvideo anschaulich darstellen. Dies fördert das Verständnis insbesondere bei Patientengruppen mit geringer Gesundheitskompetenz oder Sprachbarrieren (viele Tools bieten Mehrsprachigkeit an). Medudoc etwa setzt auf videobasierte, personalisierbare Patientenaufklärung, die auf Leitlinieninhalten basiert und juristisch geprüft ist Solche Inhalte können exakt an die individuelle Indikation des Patienten angepasst werden – ein großer Vorteil gegenüber statischen Einheitsformularen.
Remote Consent und Telemedizin: Mit Aufkommen der Telemedizin stellt sich die Frage, wie informierte Einwilligung funktionieren kann, wenn Arzt und Patient sich nicht physisch gegenüberstehen. In der COVID-19-Pandemie wurden beispielsweise vermehrt Behandlungen per Videosprechstunde initiiert. Grundsätzlich gelten die gleichen Anforderungen: der Arzt muss den Patienten via Video oder Telefon genauso verständlich aufklären und das Einverständnis einholen. Die technischen Mittel erlauben inzwischen, Formulare digital zu übermitteln und elektronisch unterschreiben zu lassen. Remote Consent Plattformen (einschließlich medudoc) bieten Fernsignaturen an, die den gesetzlichen Schriftformerfordernissen genügen. In Österreich wurde 2022 im Ärztegesetz klargestellt, dass unter bestimmten Bedingungen auch telemedizinische Aufklärung zulässig ist, sofern Dokumentation und Identitätsfeststellung gewährleistet sind. In Deutschland hat die Bundesärztekammer telemedizinische Aufklärung in ihren (Muster-)Berufsordnungen ermöglicht, solange die Qualität der Kommunikation sichergestellt ist (z.B. gute Videoverbindung, ausreichend Zeit).
Rechtliche Anerkennung elektronischer Einwilligungen: Ein wichtiger Aspekt ist die rechtliche Gleichstellung elektronischer Signaturen. EU-weit regelt die eIDAS-Verordnung, dass eine qualifizierte elektronische Signatur der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist. Lösungen wie medudoc nutzen solche Technologien, um rechtssichere digitale Einwilligungen zu ermöglichen. Das bedeutet, ein Patient kann z.B. zu Hause via Smartphone das Aufklärungsvideo schauen, Fragen per Chat stellen, dann ein digitales Formular lesen und per Klick/Signaturpad unterschreiben. Die Signatur wird zertifiziert und fälschungssicher gespeichert. Der Arzt zeichnet gegen und erhält ein PDF für die Akte. Die IT-Sicherheit und Datenschutz sind dabei besonders relevant: Medizinische Aufklärungsdaten sind höchstsensible Gesundheitsdaten, die nur in sicheren, ggf. ISO 27001-zertifizierten Umgebungen verarbeitet werden dürfen.
Chancen der Digitalisierung: Sie kann die Effizienz steigern – Studien mit digitalen Aufklärungssystemen zeigen teils erhebliche Zeiteinsparungen für Ärzte (bis zu 50–70 % weniger Aufwand) bei gleichzeitig höherer Patientenzufriedenheit. Patienten können Informationen in ihrem eigenen Tempo aufnehmen, zurückspulen, Angehörige einbinden. Verständnisschwierigkeiten lassen sich mit interaktiven Quiz oder Rückfragen-Tools erkennen und adressieren. Außerdem ermöglicht die Digitalisierung eine standardisierte Qualität: Jeder Patient bekommt vollständige, leitlinienkonforme Infos, kein Aspekt wird vergessen.
Herausforderungen der Digitalisierung: Allerdings muss man darauf achten, dass der persönliche Kontakt nicht verloren geht. Technikaffine Patienten begrüßen eConsent-Methoden, doch andere – etwa ältere oder weniger technikversierte Menschen – können überfordert sein. Hier ist ein hybrider Ansatz sinnvoll: digitale Hilfe plus persönliches Gespräch. Zudem ist die rechtliche Akzeptanz digitaler Aufklärung noch im Wandel. Gerichte haben sich bislang selten mit rein digital durchgeführten Einwilligungen befasst. Wichtig ist, dass nachweisbar bleibt, wer wann was gesehen und verstanden hat. Ein systematisches Logging (Protokoll) des digitalen Prozesses schafft hier Transparenz.
Auch die Telemedizin wirft Fragen auf: Darf ein Patient per Video in eine Operation einwilligen, die Tage später durchgeführt wird, ohne den Operateur je persönlich getroffen zu haben? In der Praxis wird meist so verfahren, dass spätesten am OP-Tag ein kurzes persönliches Gespräch stattfindet (z.B. Patient trifft Operateur vor Narkose), um final offene Fragen zu klären. Rein rechtlich könnte aber die vorherige Video-Aufklärung genügen, solange alle Anforderungen erfüllt und dokumentiert wurden.
Datenschutz ist schließlich zu beachten: Digitale Aufklärungsplattformen verarbeiten personenbezogene Gesundheitsdaten, die besonders geschützt sind (DSGVO, österr. DSG). Patienten müssen einwilligen, dass ihre Daten elektronisch verarbeitet werden (dies geschieht meist zusammen mit der Behandlungseinwilligung).
Insgesamt nimmt die Relevanz von Digital Health Lösungen in der Patientenaufklärung deutlich zu. Telemedizinische Einwilligungen werden in Zukunft wahrscheinlich zum Alltag gehören – z.B. bei Vorbereitung von Operationen überregional, Zweitmeinungen, oder in der dezentralen klinischen Forschung (Stichwort eConsent in Studien). Die Grundprinzipien bleiben aber unverändert: informieren – verstehen lassen – Fragen klären – zustimmen lassen – dokumentieren. Die Technik kann den Prozess unterstützen und effizienter gestalten, darf aber den menschlichen Faktor nicht eliminieren.
9. Referenzkapitel: Relevante Gesetzesnormen und deren Bedeutung
Deutschland
Zum Abschluss ein Überblick wichtiger gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit der informierten Einwilligung und was sie bedeuten:
- § 630d BGB – Einwilligung: Teil des deutschen Patientenrechtegesetzes. Verpflichtet den Behandelnden, vor jedem medizinischen Eingriff die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsunfähig, muss ein Berechtigter (Betreuer/Bevollmächtigter) zustimmen, sofern nicht eine Patientenverfügung greift. Ohne Einwilligung darf nur im Notfall entsprechend dem mutmaßlichen Willen gehandelt werden. Diese Norm etabliert die Einwilligung als conditio sine qua non jeder Behandlung.
- § 630e BGB – Aufklärungspflichten: Regelt in Deutschland inhaltlich und formal, wie die Patientenaufklärung zu erfolgen hat. Abs. 1 listet die wesentlichen Umstände auf: Art, Umfang, Risiken, Notwendigkeit, Dringlichkeit, Erfolgsaussichten und Alternativen der Maßnahme. Abs. 2 schreibt vor, dass die Aufklärung mündlich, rechtzeitig und verständlich durch den Arzt (oder fachkundigen Mitarbeiter) erfolgen muss. Außerdem sind dem Patienten Kopien aller von ihm unterschriebenen Unterlagen auszuhändigen. Abs. 3 erlaubt Ausnahmen (Entbehrlichkeit), etwa wenn der Patient keine Aufklärung wünscht oder bei akuter Lebensgefahr keine Zeit bleibt. Abs. 4–5 regeln die Aufklärung gegenüber Bevollmächtigten bzw. beschränkt einsichtsfähigen Patienten (z.B. Kindern) analog. Diese Norm konkretisiert also, was und wie aufzuklären ist.
- § 630f BGB – Dokumentation der Behandlung: Schreibt vor, dass eine Patientenakte zu führen ist, unmittelbar zeitnah zur Behandlung, elektronisch oder in Papierform. Abs. 2 BGB legt den Mindestinhalt fest: „sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse“ sind zu dokumentieren, insbesondere Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Befunde, Therapien und Eingriffe. Daraus folgt, dass auch Aufklärungsgespräche und Einwilligungen als wesentliche Maßnahmen dokumentiert werden müssen. Abs. 3 verbietet unzulässige Änderungen (Manipulationsverbot). Diese Norm gewährleistet eine vollständige Behandlungsdokumentation, die auch der Beweissicherung dient.
- § 630h BGB – Beweislast bei Haftung für Aufklärungsfehler: Besagt in Abs. 2: Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er die Einwilligung eingeholt und ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Gelingt ihm das nicht, wird zulasten des Arztes vermutet, dass ein Aufklärungsfehler vorlag, der kausal für einen Schaden war. Diese Norm kehrt also die Beweislast im Prozess um und macht die lückenlose Dokumentation so wichtig.
- § 223 StGB – Körperverletzung (DE): Definiert die einfache Körperverletzung. Relevant hier: Jede ärztliche Handlung, die die körperliche Unversehrtheit berührt (Spritze, OP-Schnitt etc.), erfüllt den objektiven Tatbestand. § 228 StGB – Einwilligung: stellt klar, dass eine mit Einwilligung vorgenommene Körperverletzung nicht rechtswidrig ist, sofern sie nicht gegen die guten Sitten verstößt. Für die Medizin bedeutet das: Eine ordnungsgemäß eingeholte Einwilligung rechtfertigt den körperlichen Eingriff, und der Arzt bleibt straffrei. Ohne Einwilligung wäre der Arzt wegen (gefährlicher) Körperverletzung strafbar, selbst wenn der Eingriff medizinisch indiziert war.
Österreich
Zum Abschluss ein Überblick wichtiger gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit der informierten Einwilligung und was sie bedeuten:
- ABGB §§ 252–255 (AT): Enthalten seit 2018 die zivilrechtlichen Regelungen zur Einwilligung in medizinische Behandlungen. § 252 ABGB: Eine einsichts- und urteilsfähige volljährige Person kann nur selbst einwilligen. Definiert auch „medizinische Behandlung“ und stellt klar, dass Angehörige anderer Gesundheitsberufe denselben Regeln unterliegen. § 253 ABGB: Regelt die Behandlung bei nicht entscheidungsfähigen Erwachsenen – Zustimmung durch Vorsorgebevollmächtigten/Erwachsenenvertreter nötig, außer bei Gefahr in Verzug (Notfall). Enthält auch die wichtige Abs. 4: Liegt eine verbindliche Patientenverfügung vor, die die Behandlung untersagt, muss diese respektiert werden (keine Vertreterentscheidung nötig). § 254 ABGB (der Vollständigkeit halber): Betrifft Einwilligung in medizinische Behandlungen bei Eingriffen mit besonders schweren Folgen – hier sind zusätzlich gerichtliche Genehmigungen nötig (z.B. dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit, § 255 ABGB regelt solche Sonderfälle). Zusammen sichern diese Paragraphen die Patientenautonomie ab und legen das Verfahren bei fehlender Entscheidungsfähigkeit fest.
- § 173 ABGB (AT): Spezielle Bestimmung für Minderjährige. Absatz 1: Ein entscheidungsfähiges Kind (i.d.R. ab ~14 Jahren wird das vermutet) kann selbst einwilligen; ist es nicht entscheidungsfähig, entscheiden die Obsorgeberechtigten. Absatz 2: Bei gravierenden Eingriffen braucht selbst ein entscheidungsfähiges Kind zusätzlich die Zustimmung des Obsorgeberechtigten Absatz 3: Notfallregelung – bei Lebensgefahr/ernster Gesundheitsschädigung darf auch ohne Zustimmung behandelt werden. Diese Norm soll Minderjährige schützen und gleichzeitig ihre wachsende Autonomie berücksichtigen.
- Ärztegesetz 1998 § 51 (AT): Verpflichtet Ärzte, Aufzeichnungen über jede Behandlung zu führen (Krankengeschichte). Darunter fallen Aufnahmebefunde, Anamnese, Diagnosen, Therapien etc. und – implizit – auch Aufklärung und Einwilligungen. Patienten (bzw. ihre gesetzlichen Vertreter) haben Anspruch auf Auskunft und Einsicht. Damit ist die ärztliche Dokumentationspflicht in Österreich gesetzlich verankert, ähnlich § 630f BGB.
- Patientenverfügungs-Gesetz (PatVG, AT): Regelt verbindliche und beachtliche Patientenverfügungen. § 2 PatVG definiert die Patientenverfügung als Willenserklärung, in der ein Patient eine künftige Behandlung ablehnt, die gelten soll, wenn er nicht entscheidungsfähig ist. § 6 PatVG (nicht im Text oben zitiert): legt die Voraussetzungen für verbindliche Verfügungen fest – u.a. ärztliche Aufklärung, Rechtsbelehrung, Schriftform mit Unterschrift vor Notar/RA/Patientenanwalt. § 7 PatVG: Dauer der Verbindlichkeit (8 Jahre). § 8 PatVG: beachtliche PV (Form nicht erfüllt) sind als Anhaltspunkt zu berücksichtigen. Das PatVG sorgt dafür, dass der in einer Patientenverfügung festgehaltene Wille im Ernstfall umgesetzt wird und gibt Ärzten Rechtssicherheit, wenn sie sich daran halten.
Diese Normen bilden den rechtlichen Rahmen, in dem sich Ärzt:innen und medizinisches Personal bei der Patientenaufklärung bewegen. Sie zeigen klar: Die informierte Einwilligung ist keine bloße Formalie, sondern gesetzlich geschütztes Recht des Patienten – zugleich „Schutzschild“ für den Arzt, der sich daran hält. Rechtsquellen und Leitlinien untermauern diesen Rahmen (siehe externe Links). Im Ergebnis fördern diese Bestimmungen das Vertrauensverhältnis: Gut informierte Patienten können in die Behandlung einwilligen, was nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch und therapeutisch die beste Grundlage für den Behandlungserfolg darstellt.